Kurzmeditation
Datum: 21.01.2011 | Autor: Elke | Kategorien: Texte | 1 Kommentar »In der >> Frankfurter Rundschau spricht der Nobelpreisträger >> Amartya Sen über Gerechtigkeit und den Begriff der Aufklärung. Und, Hand auf’s Herz, denken wir da nicht alle ein bißchen eurozentrisch? Umso interessanter ist es, Sens Ausführungen zur Aufklärung in anderen kulturellen Kontexten zu lesen. Mein Lieblingssatz aus diesem Interview lautet deshalb: “Faktisch bedeutet der Name Buddha Aufklärung.”
Der Ausgangspunkt für soziale Gerechtigkeit müsse Sen zufolge nicht im Bild einer utopisch gerechten Welt gesucht werden, sondern im Handeln, das weniger Ungerechtigkeit erzeugt. Ausgehend von den fernöstlichen Konzepten “Nyaya” und “Neeti” richtet Sen damit den Blick auf die soziale Praxis: “Menschen denken über ihr Verhalten nach. Aber oft spielt es nur eine untergeordnete Rolle. Man setzt die richtigen Institutionen ein und hofft, optimistischer Weise, dass sich alles zum Besten fügen wird. Wie in der Demokratie. Es gibt Wahlen, was willst du mehr? Tatsache ist aber, dass man viel mehr benötigt, um eine Demokratie zu realisieren.” Sehr schön ist zudem sein Argument, dass es wirklich nicht schwer sei eine Hungersnot zu stoppen: “Das durch Hungersnöte verursachte Elend ist so extrem, dass es einfach ist, Mitgefühl zu haben. Hingegen ist eine sich fortsetzende, wenngleich nicht akute Unterernährung eine viel kompliziertere Notlage, die eine tiefergehende gedankliche Analyse ebenso erfordert wie ein intelligentes Verstehen ihrer bösartigen Folgen. Dies sind die fehlenden Textstücke des Verhaltens, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die Tolerierung der Unterernährung spiegelt unsere intellektuelle und politische Faulheit wider. Wir denken nicht genug über menschliche Entbehrungen in all ihren Manifestationen nach.”
Und damit schalten wir zurück nach Deutschland.  Ebenfalls in der >> Frankfurter Rundschau plädiert die Caritas für “einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. Wir haben einen hohen Prozentsatz an Menschen, die nicht mehr in ein normales Arbeitsverhältnis zu integrieren sind.” Also kann man sie, dies muss man aus der Formulierung schließen, nur in einen unnormalen Arbeitsmarkt integrieren: “Arbeit hat nicht nur einen materiellen, sondern auch einen sozialen und gesellschaftlichen Wert. Das war für uns auch erstaunlich, dass für viele Hilfeempfänger die Ein-Euro-Jobs eine gewisse Attraktivität haben. Sie haben das Gefühl, wieder zur Gesellschaft dazuzugehören.”
Ebenfalls in der >> Frankfurter Rundschau plädiert die Caritas für “einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. Wir haben einen hohen Prozentsatz an Menschen, die nicht mehr in ein normales Arbeitsverhältnis zu integrieren sind.” Also kann man sie, dies muss man aus der Formulierung schließen, nur in einen unnormalen Arbeitsmarkt integrieren: “Arbeit hat nicht nur einen materiellen, sondern auch einen sozialen und gesellschaftlichen Wert. Das war für uns auch erstaunlich, dass für viele Hilfeempfänger die Ein-Euro-Jobs eine gewisse Attraktivität haben. Sie haben das Gefühl, wieder zur Gesellschaft dazuzugehören.”
Arbeitswelten, buddhistisch
Vielleicht müßte hier das von Sen geforderte Nachdenken einsetzen. Denn es ist sicher so, dass Arbeit zur Seinsbestimmung des Menschen in der Moderne wurde und gesellschaftliche Integration über Arbeit verläuft. Die neue soziale Frage lautet deshalb – so Robert Castel – wie man Menschen integriert, wenn die Arbeitswelten erodieren. Die bisherigen Lösungen wie Ein-Euro-Jobs mögen also Menschen das Gefühl gesellschaftlicher Teilhabe geben, sie basieren aber auf einer Art Placebo-Arbeitswelt. Denn tatsächlich will keiner etwas von ihnen. Die Beweislast liegt also bei den Eigentlich-Exkludierten: Sie zeigen sich und anderen, dass sie doch noch irgendwie dazugehören. Vielleicht muss der Begriff der Arbeit als Zwangsregime gesellschaftlicher Integration wirklich einmal buddhistisch angegangen werden: “Tu was du willst – aber nicht, weil du musst.” (Buddha)
Photo: Erwerbslosen Forum Deutschland

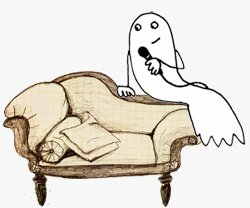

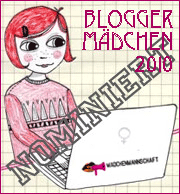


[...] Elke Brüns sinniert über den “Begriff der Arbeit als Zwangsregime gesellschaftlicher Integration“. [...]