Zur Kasse, bitte!
Datum: 25.02.2010 | Autor: Elke | Kategorien: Texte | Tags: Anna Sam, Burkhart Spinnen, Michel Houllebecq, Supermarktkassiererin, Tatort, Wilhelm Genazino | 1 Kommentar »Sicherlich gab es Zeiten, in denen die Entlassung einer Supermarktkassiererin, der der Diebstahl eines 1,30-Euro-Pfandbons zur Last gelegt wird, weniger die Gemüter bewegt hätte. Doch im Zeichen einer globalen Krise, in der unvorstellbare Geldmengen in notleidende Banken gepumpt werden, zeigt sich das kollektive Gerechtigkeitsempfinden erschüttert. Angeprangert wird die mittlerweile schon sprichwörtliche „Selbstbedienungsmentalität der Manager“, der jedes Empfinden für sozial angemessenes Verhalten in Krisenzeiten fehlt. Mit der geschassten Kassiererin und den sich selbst bedienenden Managern wird der Supermarkt zum Imaginationsraum sozialer Ungerechtigkeit. Metapher und Realität stoßen dort aufeinander, wo die Rechnung präsentiert wird: an der Kasse. Und genau hier zeigt sich eine neuralgische Leerstelle: Die Kassiererin ist entlassen, die Kasse verwaist und ohne jede Rechnung für ihr Tun und Treiben verlassen die Manager den Selbstbedienungsladen mit vollen Taschen.
Kassiererinnen, sonst eher übersehene Wesen, genießen im Moment ungeahnte Popularität. Der Überraschungserfolg Die Leiden einer jungen Kassiererin der französischen Autorin Anna Sam ist so gesehen weniger erstaunlich als vielmehr der vom Internet Blog zum Buch geadelte Beleg, dass die Kassiererinnen als Protestikonen einer neu entdeckten Arbeitswelt dienen: Vorkämpferinnen sozialer Gerechtigkeit, unterbezahlte, geduldige und dabei gewitzte Opfer schlechter Manieren und Schikanen. Sogar der Tatort, kollektivimaginär auf der Höhe der Zeit, machte kürzlich eine Kassiererin zur Mörderin. Angesichts der Behandlung, die sie in einem Discounter erdulden musste, würde wohl jeder Zuschauer umstandslos auf Freispruch plädieren.
In der Supermarkt-Literatur der 90er Jahre haben auch die Schriftsteller die Kasse als Topos lebensrelevanter Fragen entdeckt. Angeblich wird ja an Supermarktkassen nur der von Niklas Luhmann ausgemachte Entscheidungscode der Wirtschaft – zahlen oder nicht zahlen – exekutiert. Bares oder Karte gezückt und vorgerückt in die Sphäre der Geldbesitzer, Zahlungsfähigen, Kreditwürdigen. Doch gelegentliche Pannen beim Übergang vom genussvoll einkaufenden zum zahlungsfähigen Kunden – nicht genug Geld eingesteckt, die Karte funktioniert nicht – geraten schnell zur Peinlichkeitsstolperschwelle: Alle schauen zu, wie jemand seine Rechnung nicht begleichen kann – und jeder denkt sich seinen Teil.
Denn auch ohne Pannen ist die Kasse eine rite de passage, die nur robustere Naturen ohne Anfechtung überstehen. In Burkhart Spinnens Roman Langer Samstag möchte der gut situierte Firmenjurist Lafort lieber Kassierer als Kunde sein. Denn für jeden Kunden gilt: „Ohne Zweifel ist ihm, was er gekauft hat, peinlich.“ Wie der unerschrockene TV-Psychologe Tony Hill, der neulich aus einem nicht zusammenpassenden Einkauf ein Profil eines gesuchten schizophrenen Mörders erstellte, weiß auch Lafort, dass jeder Warenkorb eine Geschichte erzählt: „Jedes Fertiggericht setzt den Besitz von Küchengeräten voraus; Toilettartikel lassen auf kleine Gebrechen schließen, Sonderangebote auf gewisse Vorlieben; no Name-Produkte vielleicht auf Armut und Elend?“
Ein Elend ganz anderer Art beschreibt Michel Houllebecq: Die Welt als Supermarkt – der deutsche Titel seiner Essays – bringt die marktanalytische Perspektive des Autors auf den Punkt. In dieser von Zerstreuung, Verblendung und Warenkonkurrenz diktierten Welt regiert der Kampfhedonist. Dessen Beziehungen sind warenförmig organisiert, als Käufer sortiert er das Angebot, als sexuell attraktives Produkt hofft er ausgewählt zu werden. Orientierung im Sinnlosen bietet nur ein Begehren, das einzig als Funktion der Werbung erscheint.
Wie anders Wilhelm Genazino! Dieser lässt in Die Kassiererinnen einen seiner sympathisch verschluffelten Helden ausgerechnet im Supermarkt den Sinn des Lebens suchen. Zwar rufen die Kassiererinnen – dauernd vom Filialeiter wegschickbar, dauernd vom Kunden anblickbar – „ein Gefühl der Weltbitternis“ in ihm hervor, doch seien sie der „Fatalität ihres Schicksals“ gewachsen. Liebevoll stattet er sie mit Geschichten aus, indem er jede Kassiererin eine Biographie andichtet und sie zu „Integrationsfiguren des Alltags“ verklärt. Leider ist die Realität mal wieder viel prosaischer: Der Erzähler entdeckt, dass zwei Kassiererinnen mit Drogen dealen – vermutlich, um ihre Familien durchzubringen.
Das Abseits lauert in der Supermarkt-Literatur der 90er Jahre überall: Spinnen erzählt vom Selbstmordversuch einer überlasteten Angestellten und gibt en passant auch die Biographie eines Obdachlosen wieder. Genazinos Erzähler sieht dauernd „Drogenabhängige, Alkoholiker, Arbeitslose, Motorradfahrer und endgültig verstummte Sozialhilfeempfänger, die mit schwammartiger Traurigkeit in die Schaufenster blickten“. Noch ist man drinnen, im Kaufland Deutschland, aber das soziale Elend schaut im Wortsinne schon herein.
Begibt man sich in den Imaginationsraum Supermarkt, so läuft man offenbar immer Gefahr, nicht ganz unversehrt wieder herauszukommen. So gestaltet sich der Supermarkt literarisch zunächst als Versprechen: Sinnbild all der schönen Überraschungen, die das Leben so bietet. Doch am Ende wird immer die Rechnung präsentiert. Und so werden die Damen an der Kasse zu Allegorien eines Lebens, das sich schlussendlich als Bilanzierung versteht.
Mit Annas Sams Die Leiden einer jungen Kassiererin Sam wird der Supermarkt gewissermaßen vom Kopf auf die Füße gestellt. Hier taucht plötzlich die Arbeitswelt auf, die in der Literatur immer einen schlechten Stand hat – außer man schreibt so furiose wir-schlafen-nicht-Bücher wie Kathrin Röggla oder so abgründig-gemeine Wirtschaftsromane wie Ernst-Wilhelm Händler. Bei Sam werden weder neue postfordistische Arbeitsverhältnisse noch Finanzmentalitäten erkundet. Die ehemalige Kassiererin, die ihren Kassenplatz als Logenplatz eines zumeist unschönen Alltagstheaters erlebte, zeigt die Wahrnehmung von dem Ort aus, der Kunden wie Literaten bislang als Projektionsfläche diente. Buchstäblich wird hier der Blick nach unten, der in der tiefer sitzenden Kassiererin so sinnfällig das Soziale verkörpert, zum Blick von unten. Kein Wunder, dass dieser Blick im Moment so interessant ist, denn nicht nur in der Literatur des Supermarktes, sondern auch in der ganz realen Welt werden ja gerade alle zur Kasse gebeten.

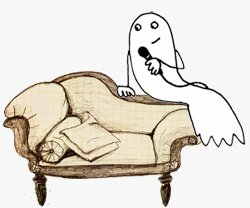

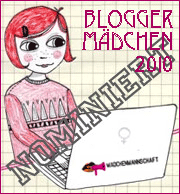


[...] Als Fall Emmely findet sich die Kündigung einer Kassiererin wegen angeblicher Unterschlagung zweier Pfandbons im Wert von 1, 30 € sogar in Wikipedia verzeichnet. Nun hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt die Kündigung aufgehoben. Das Urteil erfreut den Gerechtigkeitssinn. Hier ein durch die damalige Kündigung inspirierter Text zur Literatur des Supermarktes. [...]