Flashback: Pinky und Boris. Über Armut in der DDR-Kinderliteratur
Datum: 02.10.2010 | Autor: Elke | Kategorien: Gastbeiträge, Heide Reinhäckel | Tags: Armut im DDR-Kinderbuch, Detektiv Pinky, Tag der Deutschen Einheit | 2 Kommentare » Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit bringt Gespenst der Armut einen Gastbeitrag der Literaturwissen schaftlerin >> Heide Reinhäckel. Sie wuchs in Halle auf, Vorstellungen von fernen und auch näher gelegenen Ländern vermittelten ihr die Kinderbücher der DDR. So auch die Reihe um den beliebten >> Detektiv Pinky, der als Waisenjunge in Amerika lebt.
Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit bringt Gespenst der Armut einen Gastbeitrag der Literaturwissen schaftlerin >> Heide Reinhäckel. Sie wuchs in Halle auf, Vorstellungen von fernen und auch näher gelegenen Ländern vermittelten ihr die Kinderbücher der DDR. So auch die Reihe um den beliebten >> Detektiv Pinky, der als Waisenjunge in Amerika lebt.  Boris, der zweite Kinderheld lebt in West-Berlin. Beide Kinder erleben Armut: Erstaunlich und unerwartet ist allerdings wie unterschiedlich ein DDR-Kinderbuch und ein als Lizenzausgabe in der DDR erscheinendes BRD-Kinderbuch diese schildern.
Boris, der zweite Kinderheld lebt in West-Berlin. Beide Kinder erleben Armut: Erstaunlich und unerwartet ist allerdings wie unterschiedlich ein DDR-Kinderbuch und ein als Lizenzausgabe in der DDR erscheinendes BRD-Kinderbuch diese schildern.
Heide Reinhäckel
Pinky und Boris. Über Armut in der DDR-Kinderliteratur
Pinky habe ich in einem Antiquariat in der Berliner Chauseestraße wiedergefunden und Boris ein Jahr später auf dem Verschenktisch einer Stadtbibliothek. Beide hatte ich lange aus den Augen verloren, aber erkannte sie sofort wieder – auf Buchcovern. Die beiden zwölfjährigen Jungen waren die Helden in zwei DDR-Kinderbüchern, die unterschiedliche Geschichten über Kinderarmut in den USA und in West-Berlin erzählten.
„Pinky saß auf seiner Mülltonne und träumte“ begann jedes Kapitel in Gert Prokops 1982 erschienen Kinderbuch Detektiv Pinky. Das Cover von Klaus Vonderwerth zeigte einen Jungen in Turnschuhen, Röhrenjeans, Ringel T-Shirt vor einer amerikanischen Straßenkulisse. Das Buch erzählte über einen zwölfjährigen Waisenjungen, der sich nach seinem Vorbild, dem Detektiv Allan Pinkerton, Pinky nennt und in der fiktiven amerikanischen Stadt Kittsburgh in einem heruntergekommenen Waisenhaus lebt. Wie sein Vorbild löst Pinky mit etwas Glück und scharfem Verstand Kriminalfälle, meist für die Reichen der Stadt.
Detektiv Pinky brachte mir die ersten Englischvokabeln bei und führte zugleich in die amerikanische Populärkultur und Architektur ein, wenn beispielsweise der Begriff Hamburger unterhalb des Textes mit der Anmerkung „warmes Sesambrötchen mit einer Scheibe gebratenen Hackfleisch, Gurke, Tomate, Salat, Senf und Ketschup“ erklärt wurde oder die Kinder über die Dächerlandschaften der Backsteinhäuser sprangen. Wahrscheinlich war es die Freundschaft zwischen Pinky und seinem besten Freund Monster, ihr Witz und Widerstand gegen das lieblose und geizige Ehepaar Potter, die das Waisenhaus leiteten, die das Buch zum Leseerlebnis machten. Bei der Lösung eines Falles handelte Pinky Geschenke für alle Kinder im Waisenhaus heraus und ein Tier für den Kittsburgher Zoo. Pinky war ohne Zweifel der Held meiner Kindheit und prägte mein erstes Amerikabild als visueller Code, der sich jahrzehnte später in New York bestätigte. Obwohl Pinky „Second-hand-Klammotten“ trug, noch ein Wort, das ich lernte, und die Verhältnisse im Waisenhaus bescheiden waren, fand er immer einen Ausweg, oft über die Feuerleiter, über die Phantasie und mit Hilfe seiner Freundschaften. Diese Fähigkeit ließ ihn nicht nur arm erscheinen, sondern eher wie einen Bruder von Tom Sawyer. So zeichnete Detektiv Pinky zwar ein kritisches Sozialporträt der amerikanischen Gesellschaft, das aber durch die Krimi-Episodenplots und die Figurencharakterisierung nie ins Ideologische abdriftete.
Boris, Kreuzberg, 12 Jahre von Jochen Ziem war dagegen Pflichtlektüre an der Polytechnischen Oberschule (POS). Der Kinderbuchverlag Berlin hatte das Buch 1988 als Lizenzausgabe von einem Münchner Verlag veröffentlicht. So lag kurz vor dem Mauerfall noch ein Buch in den Klassenzimmern, das ein kritisches Bild der sozialen Lage in der BRD zeichnete.
Im Gegensatz zu Detektiv Pinky war die Lektüre verstörend. Bereits der nüchterne, an eine Sozialreportage erinnernde Titel verkündete die Programmatik des Buches, das eine Art Günter Wallraff für Kinder darstellte, so nüchtern und nahezu authentisch erschien es durch seine alltagsnahe Sprache. Es erzählte über Boris, der zwar noch nicht ganz unten, aber auf dem Weg dorthin war.
Er ist Halbwaise, die Mutter lebt von der Sozialhilfe und vom Alkohol, sie wohnen in einer Hinterhauswohnung ohne Waschmaschine und Dusche. Er kauft sich zum Frühstuck „im nahen Supermarkt eine Tüte Kartoffelchips und eine große Flasche Cola, klaute noch eine Päckchen Kaugummi“. Mit dieser Skizze ist schon Boris Entwicklung beschrieben, die nicht weit führt. Er schwänzt die Schule, die Klasse mobbt ihn. Einzig ein engagierter Referendar nimmt sich seiner an, scheitert selbst aber wiederum am Schulsystem und bekommt keine Stelle. Wenn Boris ihm erzählt: „Aus die Wohnung ham se uns jefeuert. Und die Alte is inne Anstalt. Macht doch nix“ klingt dies nicht wie die Aussage eines zwölfjährigen, sondern mehr nach 50 Jahre Hoffnungslosigkeit. Dass die Zukunft aufgrund der sozialen Lage schon determiniert ist, erscheint als das Brutale des Romans. Denn Boris träumt niemals, hat kein Herz für Tiere, sondern schießt auf Ratten mit seinem Katapult. So zeigt das Cover auch einen Jungen vor staubiger Fassade, der seltsam verkrampft eine Steinschleuder hält, vielleicht im Wissen, dass er eigentlich der Gejagte ist, ihm die Ablehnung und Aggression der Gesellschaft trifft.
Bei meinen Recherchen überraschte es mich, dass Boris, Kreuzberg, 12 Jahre 2010 in der 13. Auflage erschien. Einerseits wohl ein Indiz für die Aktualität und Problematik von Kinderarmut, andererseits bleibt zu fragen, ob sich die Bilderwelten der Armut nicht teilweise geändert haben, wie beispielsweise der neue Film >>Die Entbehrlichen von Andreas Arnstedt zeigt, der wiederum über einen zwölfjährigen Jungen erzählt und aktuelle, nun gesamtdeutsche Bilder für Kinderarmut findet.
Und hier Pinky in Aktion, eine freie Adaption

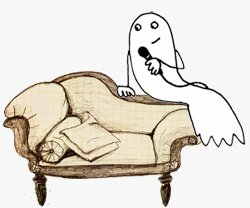

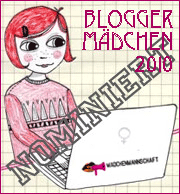


Liebe Elke,
interessante Fundstücke hast du hier! Vor allem “Detektiv Pinky” hat’s mir sehr angetan. Ich liebe kleine und große Träumer dieser Welt… und ein Bruder von Tom Sawyer ist auch mein Bruder. : ) Es könnte in jedem Fall auch ein Buch für meine lesebegeisterte Nichte sein, die nun dabei ist, die englische Sprache zu erlernen. Vielen, vielen Dank also dafür.
Das freut mich sehr! Es wäre auch schade, wenn dieses Buch unterginge, “nur” weil die DDR untergegangen ist.
Viel Spaß beim Lesen wünscht: Elke