Thomas Pogge über Menschenrechte, Philosophie und Armut
Datum: 11.07.2010 | Autor: Elke | Kategorien: Gastbeiträge, Thomas Pogge | Tags: Armut, Menschenrechte, Pogge | Keine Kommentare » >Thomas Pogge ist Professor für Philosophie und Internationale Angelegenheiten an der >Yale University. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gerechtigkeit, Kant und Armut. Als Armutsforscher geht er das Problem nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch an. So arbeitet Pogge am Entwurf eines globalen Weltgesundheitsfond (Health Impact Fund) mit.
>Thomas Pogge ist Professor für Philosophie und Internationale Angelegenheiten an der >Yale University. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gerechtigkeit, Kant und Armut. Als Armutsforscher geht er das Problem nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch an. So arbeitet Pogge am Entwurf eines globalen Weltgesundheitsfond (Health Impact Fund) mit.
Für Gespenst der Armut beantwortet er Fragen zu Philosophie und Armut, zu den Menschenrechten und zum Verhältnis von absoluter und relativer Armut.
1. Verstößt Armut gegen die Menschenrechte?
Freiheit von gravierender Armut wird weithin als Menschenrecht anerkannt. So heisst es z.B. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte [Artikel 25(1)]: “Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.”
Ein solches Menschenrecht macht Sinn, denn gravierende Armut ist mit der Würde des Menschen unvereinbar und macht ausserdem die von ihr betroffenen Personen ausserordentlich verwundbar für andere Menschenrechtsdefizite: Gewalt (wie Zwangsarbeit und –prostitution), Ausschluss von politischer Mitsprache, und so weiter. Damit ist Ihre Frage aber noch nicht beantwortet. Denn es sind ja nicht Zustände, die möglicherweise gegen die Menschenrechte verstossen, sondern Handlungen. Das macht die Sache komplizierter, weil man in Betracht ziehen muss, wie die Armut einer Gruppe von Personen in Beziehung steht zum Handeln anderer.
Nehmen wir als Beispiel die extreme Armut der Bevölkerung einer Provinz Nigerias. Einige (nigerianische Politiker, Beamten des Internationalen Währungsfonds, Manager einer multinationalen Ölfirma) mögen aktiv zu dieser Armut beitragen – und sie verletzen dann die Menschenrechte dieser Nigerianer (unter der plausiblen Annahme, dass ihnen andere Handlungsoptionen offenstehen, die keine Menschenrechtsdefizite auslösen oder verstärken würden). Andere (nigerianische und ausländische Politiker vielleicht, oder Mitarbeiter einer inkompetenten oder korrupten Hilfsorganisation) mögen passiv für jene Armut verantwortlich sein: Sie sollten und können diese Armut lindern, tun dies aber nicht. Von ihnen kann man wohl nicht sagen, dass sie die Menschenrecht verletzen, aber schon, dass ihr Handeln gegen die Menschenrechte verstösst indem es nicht in moralisch hinreichender Weise auf die Erfüllung der Menschenrechte hinarbeitet. Wieder andere (Kinder in Bangladesh, zum Beispiel) haben keinerlei Handlungsoptionen, durch die sie die Armut der fraglichen Nigerianer beeinflussen könnten. Von ihnen lässt sich nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise gegen die Menschenrechte verstossen.
2) Welche Begründungen liefert die Philosophie gegen Armut?
Darüber ließe sich leicht ein ganzes Buch schreiben. Armut belastet so ziemlich alle Aspekte menschlichen Lebens. Arme Menschen hungern und frieren oft, werden häufig krank, sterben meistens vorzeitig, oft schon in der Kindheit. Viele haben keine Schulbildung und arbeiten unter schrecklichen Bedingungen mit sehr wenig Freizeit. Und arme Menschen sind sozial und politisch ohne Einfluss, können sich oftmals gegen Misshandlung und Erniedrigung nicht zur Wehr setzen, und finden keinen Weg, sich selbst oder ihre Kinder aus der Armut zu befreien.
Ein Leben in gravierender Armut ist kein menschenwürdiges Leben, und deshalb ist es moralisch von grosser Wichtigkeit, solche Armut zu vermeiden. Konkreter: Alle (individuellen oder kollektiven) Akteure sollten mit Umsicht ihr Handeln so beschränken, dass sie nicht aktiv zur Armut anderer beitragen oder solche Armut zum eigenen Vorteil ausnutzen (Beispiele: Sextourismus, Kauf von Billigimportprodukten, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurden). Dies ist eine Spezifizierung des allgemeineren Prinzips, dass man andere nicht schädigen oder ausbeuten darf. Und nicht-arme Akteure sollten das ihrige dazu beitragen, Armut zu beseitigen, auch solche, zu der sie selbst nichts beigetragen haben. Dies ist eine Spezifizierung des allgemeineren Prinzips, dass man Menschen in ernster Not beistehen sollte.
3) Sehr häufig wird argumentiert, dass die Armut in reichen Ländern nicht vergleichbar sei mit der absoluten Armut in Schwellen- und Entwicklungsländern. Während es dort um die physische Existenz gehe, jammere man in reichen Ländern sozusagen auf hohem Niveau. In welchem Verhältnis stehen absolute und relative Armut? Muss man erst die absolute abschaffen und sich dann um die relative kümmern?
Die beiden Arten von Armut haben eine gemeinsame Wurzel: das erfolgreiche Streben einer kleinen Minderheit von Menschen, die sozialen Spielregeln (auf nationaler wie auch internationaler Ebene) so zu beeinflussen, dass sie selbst einen immer grösseren Anteil des Sozialprodukts fuer sich verbuchen können. In den USA, zum Beispiel, hat das oberste Einkommensprozent seinen Anteil am nationalen Haushaltseinkommen in den letzten 30 Jahren um das 2.6 fache steigern können: von 8,95% auf 23,5%. Das oberste Hundertstelprozent brachte sogar eine Steigerung seines Anteils auf’s Siebenfache zustande: von 0,86% auf 6,04%. Die untere Hälfte der Bevölkerung verlor im selben Zeitraum mehr als die Hälfte ihres Einkommensanteils: von 26,4% auf 12,8%. In vielen anderen Ländern, zum Beispiel in China, findet eine ähnlich rapide Polarisierung statt. Und natürlich auch in der Welt als ganzer: Zwischen 1988 und 2005 hat das ärmste Viertel der Menschheit über 20% seines Einkommensanteils verloren und liegt jetzt bei weniger als einem Prozent (0,92%) des globalen Haushaltseinkommens. Nennenswerten Zuwachs konnte nur das oberste Zwanzigstel verbuchen: sein Anteil am globalen Haushaltseinkommen wuchs von 43 auf 49%. Ein Drittel dieses Zuwachses übrigens wäre genug gewesen, um gravierende Armut ganz zu vermeiden (die untere Hälfte der Menschheit hätte dann 5% statt 3% des globalen Haushaltseinkommens gehabt).
Es ist schon richtig, dass die gravierende Armut in den armen Ländern schlimmer ist als die relative Armut in den Industriestaaten. Trotzdem ist zu sagen, dass auch relative Armut ein sehr ernsthaftes Problem (einschließlich einer erheblichen Gesundheitsbelastung) darstellt, wie zum Beispiel die Studien von Richard Wilkinson und Michael Marmot gezeigt haben.
Noch wichtiger ist, dass die Reformen, die zur Abschaffung der gravierenden Armut nötig sind, auch die relative Armut vermindern würden. Zum Beispiel: vernünftige Aussenpolitik wird sich in den USA nur dann langfristig durchsetzen können, wenn Politik dort nicht mehr einfach so von den finanzstärksten Firmen und Einzelpersonen gekauft werden kann. Diese Käuflichkeit lässt sich per Gesetz schwerlich verhindern, jedenfalls solange der oberste Gerichtshof politisch eingesetztes Geld als „freie Meinungsäußerung“ klassifiziert und unter den besonderen Schutz des First Amendment der US Verfassung stellt. Verhindern lässt sie sich durch eine (durch’s Steuerrecht erzielbare) weniger polarisierte Einkommensverteilung, die eben automatisch auch die in den USA so erhebliche relative Armut vermindern würde.

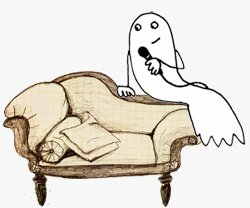

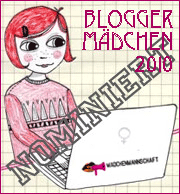


Kommentieren Sie diesen Artikel...