Gelesen: Strategien des Gegenhandelns
Datum: 27.08.2011 | Autor: Elke | Kategorien: Rezensionen | Tags: Eddie Hartmann, Jugendproteste, Strategien des Gegenhandelns | Keine Kommentare » Gegenwärtig protestiert und rebelliert die Jugend in Europa, wobei das Spektrum von den friedlichen Camps auf der Puerta del Sol in Madrid bis hin zu den exzessiven Gewaltausbrüchen in England reicht. Zugleich erinnern die jüngsten Ereignisse in England an die Gewalteruptionen in der Pariser Banlieu im Jahr 2005.
Gegenwärtig protestiert und rebelliert die Jugend in Europa, wobei das Spektrum von den friedlichen Camps auf der Puerta del Sol in Madrid bis hin zu den exzessiven Gewaltausbrüchen in England reicht. Zugleich erinnern die jüngsten Ereignisse in England an die Gewalteruptionen in der Pariser Banlieu im Jahr 2005.
Alle gleich im Protest?
Auf die Frage nach der Vergleichbarkeit der beiden Ereignisse antwortete der Eliten-Forscher Michael Hartmann im> Freitag: „In den Banlieues haben die Jugendlichen nicht die teuren Geschäfte ausgeräumt – weil es die dort gar nicht gibt. (…) Die Gettos in London sind nicht so weit weg von den Vierteln, in denen die teuren Konsumgüter angeboten werden. (…) Das ist ein Unterschied zu den Unruhen in Frankreich. Aber sonst ist das Muster genau dasselbe: Der Auslöser war derselbe: Ein Mann wurde von der Polizei erschossen. Auch die Grundlagen ähneln sich: Perspektivlosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit, wenig Bildung. Dann explodiert das kurz, man liefert sich Straßenschlachten mit der Polizei oder brennt etwas nieder. In den Banlieues haben sie Schulen angesteckt, was völlig idiotisch ist, aber das ist deren Haltung: Es ist sowieso alles egal – und wenn sich die Gelegenheit bietet zu plündern, dann wird das meistens auch wahrgenommen.“
Auf dieser Folie bietet die soziologische Dissertation von > Eddie Hartmann „Strategien des Gegenhandelns – Zur Soziodynamik symbolischer Kämpfe um Zugehörigkeit“, die sich mit den Kämpfen der jeunes de banlieu in einigen Pariser Vororten im November 2005 befasst, einen Erklärungsansatz auch für die aktuellen Ausschreitungen in England bzw. erlaubt länderübergreifende Erkenntnisse über die Formen und Konsequenzen von Exklusionsprozessen, die Eddie Hartmann ins Zentrum seiner empirischen Untersuchung stellt.
Symbolische Grenzen
Hartmann richtet er sich dagegen, die symbolischen Grenzziehungen zwischen den Vorortjugendlichen und der Mehrheitsgesellschaft als Ursache des Konfliktes zu sehen, sondern macht diese Grenzziehungen selbst zum Gegenstand der Untersuchung. Basierend auf der Prämisse, dass auch soziale Konflikte eine gesellschaftliche Beziehung darstellen – und eben keinesfalls ein Nebeneinander der Milieus – fragt er nach Genese, Ausgestaltung und Kontinuität dieser Konfliktlinien, die in den symbolischen Grenzen ihren Ausdruck finden.
Aufeinander bezogen bleiben die Milieus bereits durch die Konstruktion eines „Wir/Sie“-Schemas. Darauf aufbauend werden soziale Identitäten konstruiert, die dem Stigma des Ausgeschlossenseins und der verweigerten gesellschaftlichen Anerkennung positive eigene Wertungen und Symboliken entgegensetzen. Dies kann als Versuch verstanden werden, eine eigene Handlungsmacht durch die eigene Grenzziehungen zu gewinnen – zu fragen ist, welche Optionen in diesen symbolischen Konfliktdynamiken tatsächlich gewonnen werden können.
Hartmann unterscheidet aufgrund seines empirischen Materials (Interviews) drei verschiedene Formen der Selbstsubjektivierung: den „ambivalenten Grenzziehungstypus“, den „Umwertungstypus“ und den „Selbstausgrenzungstypus“. Bei aller Unterschiedlichkeit ist diesen jedoch gemeinsam, dass die eigenen Identitätszuschreibungen darauf abzielen, wieder Handlungsräume zu gewinnen – das Gegenhandeln, vom dem der Titel der Dissertation spricht. Dieses Gegenhandeln umfasst verschiedene Strategien, die vom scheinbar selbst gewählten Rückzug bis zur Revolte reichen. Hartmann wirft dabei die sehr interessante Frage auf, ob insbesondere die Selbstausgrenzung als ein Handeln, das darauf abzielt, der Mehrheitsgesellschaft ihr zentrales Machtmittel – die soziale Anerkennung – zu entziehen, in dem man postuliert, dass diese für einen nicht gält, ausreichen könnte, um eine wirkliche Gegenkultur aufzubauen.
Fatale Imaginationen
Wie dem auch sei, zunächst verfestigt die Soziodynamik die sozialen Differenzen, da die potentiellen Mitglieder einer von der Mehrheitsgemeinschaft als geschlossen imaginierte Gruppe (etwa „die Migrantenkinder“) sich aufgrund der mit Scham belegten Ausschließung diese Zuschreibung, eine geschlossene Gruppe zu sein, zu eigen macht – und dann zuspitzt. Nun kommt es auch seitens dieser Gruppe zu Wir-Ihr-Bildungen, die verteidigt werden, da die Zugehörigkeit zur ausgeschlossenen Gruppe mit Selbstachtung und Stolz erlebt werden kann. Nur die Idee, diese Gruppenidentiät sei eine selbst gewählte, erweist sich dabei als Phantasma: Zwar bringen diese Gruppen ihr eigenes Bild von sich hervor, aber eben nicht jenseits der bereits existenten, vorgängigen Zuschreibungen durch die Mehrheitsgesellschaft. Diese werden quasi zum „Grundmaterial“ eines storytellings über sich selber. Damit wird die Imagination einer Gruppe gesellschaftlicher „Außenstehender“ durch die Betroffenen affirmiert und zudem noch ausgebaut. Die Mehrheitsgesellschaft erhält, was sie imaginierte – auch wenn sie dabei vielleicht nicht an brennende Häuser dachte.
Eddie Hartmann: „Strategien des Gegenhandelns - Zur Soziodynamik symbolischer Kämpfe um Zugehörigkeit“. UVK Verlag, Konstanz 2010. 362 S., 44 Euro.

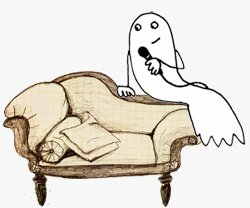

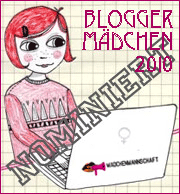


Kommentieren Sie diesen Artikel...