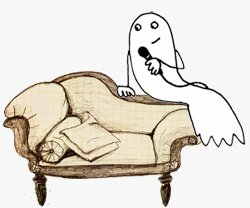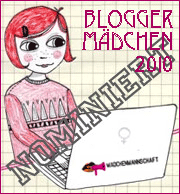Verhungern, verdursten. Der Berlin-Tatort “Machtlos” setzt (auf) Zeichen
Datum: 08.01.2013 | Autor: Elke | Kategorien: Texte, Verhungern, verdursten: Tatort "Machtlos" | Tags: ARD, Tatort, Tatort Machtlos | Keine Kommentare »Der jüngste Berlin-„Tatort“ „Machtlos“ ist ein seltsamer Fall. Uwe Braun hat Benjamin Steiner, den neunjährigen Sohn eines Bankers entführt, den ersten Teil des Lösegeldes freigiebig auf dem Alexanderplatz verteilt und sich dann freiwillig festnehmen lassen. „Er ist unzurechnungsfähig“ ruft eine Polizistin, die mit ihren Kollegen den Vorgang observiert. Doch dieser Eindruck wird schnell widerlegt.
Im Verhörraum beharrt Braun darauf, den Eltern eine Botschaft zukommenzulassen, außerdem will er durch sein Handeln „ein Zeichen setzen“. Dieses “Handeln” ist zunächst äußerst brutal: Benjamin verfüge, erklärt er den Kommissaren Ritter und Stark, nur über einen begrenzten Wasservorrat. Komme man seinen Forderungen – 10 Millionen Lösegeld – nicht nach, werde dieser verdursten.
Braun ist das Gegenteil eines gewissenlosen Kriminellen. Im Gegenteil ist er von der Lauterkeit seiner Motive überzeugt, weshalb er den Vorwürfen, er handele unrecht, bedingungslos zustimmt. Trotzdem macht er weiter, gibt das Versteck des Jungen nicht preis. Später, so insistiert er immer wieder, würde man ihn verstehen. Damit ist die Frage nach dem Motiv aufgeworfen, das in diesem Fall zum Spannungsbogen avanciert, da die Frage, ob das Kind verdursten wird, ja in einem „Tatort“ nicht wirklich spannend ist. Man weiß von vornherein: natürlich nicht. Was also treibt diesen Mann an? Was ist sein Motiv?
Zunächst scheint die Entführung aus der persönlichen Geschichte des Protagonisten zu resultieren. Braun, ehemals erfolgreicher Geschäftsmann, wurde vor Jahrzehnten durch die Kreditvergabepraktiken des noch jungen Bankers Steiner ruiniert. Belegt wird dies durch seinen damaligen Anwalt, dem hier die Rolle des alten, weisen Mannes zukommt. Kein durchtriebener Jurist, wie sonst oft, eine durch und durch ehrbare Figur betritt in dieser Folge die Szene, um die Schuldhaftigkeit des Bankers zu beglaubigen. Zwar dürfte dieser Schuldspruch angesichts des gegenwärtigen Images von Bankern auch ohne ihn auf sofortige Zustimmung in der Zuschauerschaft stoßen, doch – hier nun kommt die erstaunliche Wendung – es geht gar nicht um das Motiv „Rache“!
Zeichen setzen
Vielmehr geht es um „das Zeichen“, das Braun setzen wolle. Und hier kommt das zweite Motiv ins Spiel. Denn Braun hat sich mit den Geschäftspraktiken der Bank beschäftigt, in deren Vorstand Steiner nun sitzt und ist auf Nahrungsmittelspekulationen gestoßen. Während er sonst nur einsilbig auf die Fragen der Kommissare antwortet, erläutert er seinem angereisten Sohn ausführlich die Auswirkungen der Nahrungsmittelspekulation. In ihrer Länge und in den genauen Zahlenangaben wirkt diese kleine Rede fast wie ein Fremdkörper, wie ein Referat, das Wissen für die Zuschauer rekapituliert: Nahrungsmittelspekulationen treiben die Preise für Nahrungsmittel nach oben, sie schaffen Armut und Hunger. Allein 2010 stiegen die Lebensmittelpreise dadurch um 30%, 40 Millionen Menschen wurden in die absolute Armut gestoßen. Wieviele Kinder davon betroffen seien, könne man gar nicht ermessen. Die Politik sehe tatenlos zu. Braun nennt dies ein „unglaubliches Verbrechen“.
Und hier wird der „Tatort“ nahezu provokant. Denn eigentlich impliziert er an dieser Stelle: Was ist ein Menschenleben gegen die vielen Menschenleben, die aufgrund von Nahrungsmittelspekulationen sterben? Diese höchst unmoralische Frage stellt der Film nicht, er legt sie in diesem Moment aber nahe. Die Entführung des Bankersohnes wirkt wie eine mittelalterliche Bestrafung, die nach dem Spiegelprinzip funktionierte: Die Strafe zeigt an, was man verbrochen hat. Der abgehackte Arm spiegelt den Dieb. Hier nun sind Verdursten und Verhungern einander gegenübergestellt.
Verhungern, verdursten
Doch noch ist Braun kein Mörder, sondern „nur“ ein Kidnapper. Und Nahrungsmittelspekulationen sorgen für mehr Hunger, nicht gleich für den Tod. Doch die spiegelbildliche Struktur von Durst und Hunger verweist auf die Extremfälle, die eintreten können: Benjamin kann verdursten, Menschen können verhungern. Würde Benjamin verdursten, würde der Entführer zum Mörder. Und damit stellt sich die Frage, die der Tatort indirekt stellt: Wenn Menschen aufgrund von Nahrungsmittelspekulationen nicht „nur“ hungern, sondern sterben, ist das nicht ebenso Mord? (Jean Ziegler würde umstandslos ja sagen). Mord durch Verdursten, Mord durch Verhungern.
Kommissar Ritter weist Braun darauf hin, dass er „nicht als Robin Hood, sondern als Kindsmörder in die Geschichte“ einginge. Mit der Figur Robin Hood – den Reichen nehmen, den Armen geben – wird die politische Dimension des Falls individualisiert und romantisiert. Zum Robin Hood der traurigen Gestalt wird Braun, wenn er schließlich der Bankiersgattin nicht nur das Versteck verrät, sondern ihr auch das Versprechen abnimmt, 10 Millionen zu spenden. Als Frau Steiner mit den Kommissaren vor dem Versteck steht, beteuert sie, dass, sollte ihr Sohn überlebt haben, sie wirklich diese Summe spenden werde.
Die Lösung
Setzt nun Frau Steiner das Zeichen, das der gefangengesetzte Braun nicht setzen kann? Nein, denn er wollte – wie wirklichkeitsfremd auch immer – ein Stück Gerechtigkeit schaffen. Doch was kann die 10-Millionen-Spende für Frau Steiner bedeuten: Ein Dankesopfer, dargeboten den Armen? Von der Zeichenlogik des Films her gedacht, hätte sie sagen müssen, das sie auf jeden Fall etwas spenden werde – ob der Sohn überlebt oder nicht. Denn wenn der eigene Reichtum auf dem potenziellen Mord anderer basiert, dann gibt man unethisch erwirtschaftetes Geld zurück. So bleibt es bei einer Charity-Geste.
Doch muss man gerechterweise sagen, dass Frau Steiner gar nicht verstanden haben kann, warum sie Geld spenden soll: Das politische Motiv des Erpressers – seine Erkenntnisse über die Nahrungsmittelspekulationen – bekommt sie ebenso wenig zu hören wie ihr Ehemann. Es bleibt ein absolut pessimistischer Tatort, der seinen Titel „Machtlos“ zurecht trägt: An den Zuständen dieser Welt scheint man nichts ändern zu können. Das bleibt solange so, wie die politischen und finanzmarkttechnischen Dimensionen der Armut nicht als kriminelle erscheinen, sondern letztlich auf dem Charity-Sektor gelöst werden.